Graduiertenkolleg 516
Kulturtransfer im europäischen Mittelalter
Johannes Frey
Spielräume des Erzählens. Figurenrede und Erzähltechniken im europäischen höfischen Roman
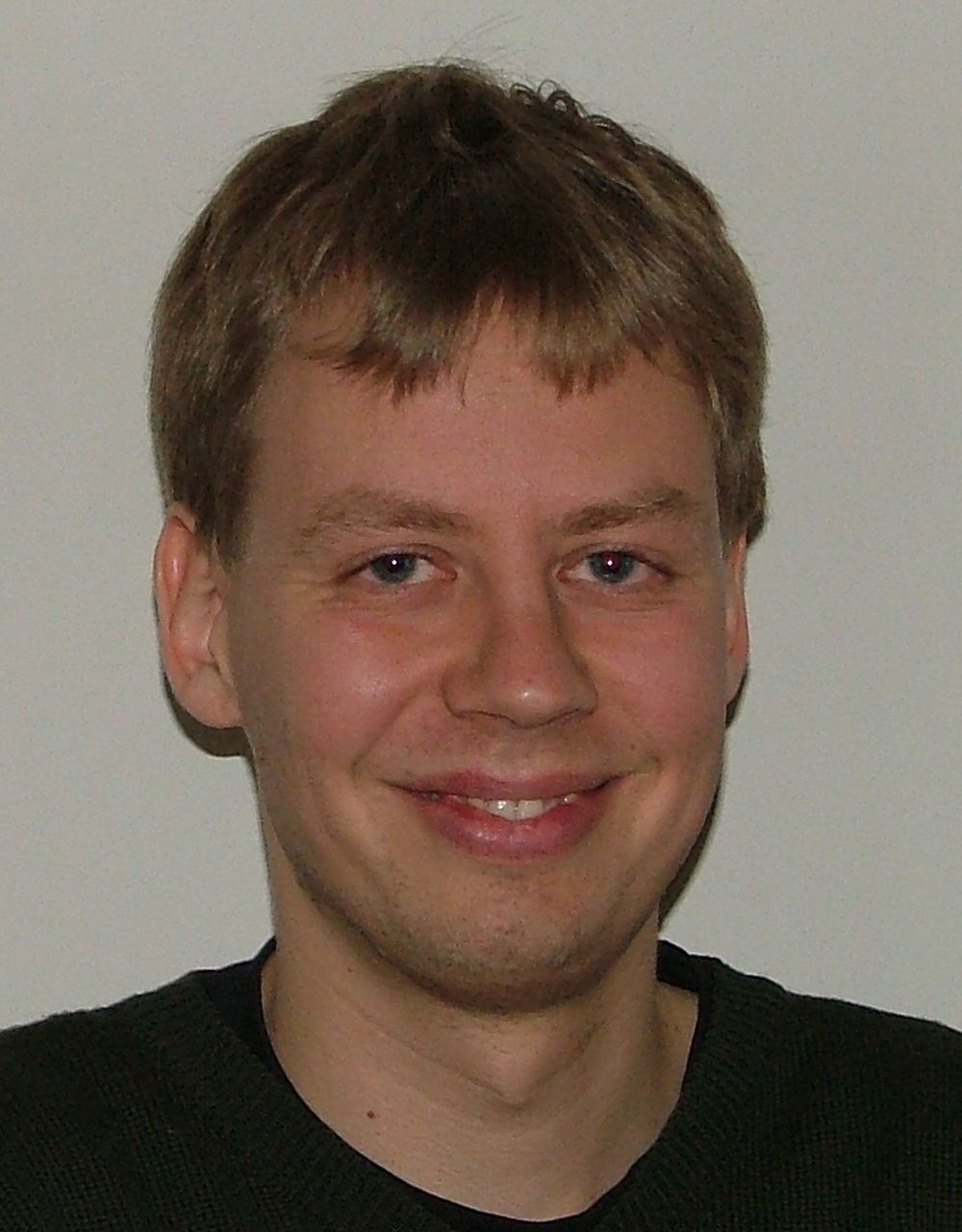 Geschichten sind seit jeher
zentraler Bestandteil kultureller Wissensvermittlung. Die unterschiedlichen
Arten und Strukturen, in denen Menschen Geschichten erzählen, geben
Aufschluss über deren Kultur, Denkweise und Weltsicht. In meiner Dissertation
untersuche ich die Entwicklung des Erzählens im europäischen höfischen
Roman (Iwein- und Tristan-Erzählungen) und damit
die teilweise sehr verschiedenen Herangehensweisen an ein- und dieselbe
Geschichte. Im Zentrum steht hierbei die Frage, ob und inwieweit die
Form des Erzählens mit dem Stoff der Erzählung gewandert ist und inwiefern
narrative Techniken der französischen Vorlagen von den deutschen,
englischen und isländischen Wiedererzählern übernommen wurden. Das
heißt: wie verändern sich Geschichten in anderen Kulturräumen, und
wie verändern sich deren Erzählmuster, um fremde Geschichten erzählen
zu können? Wie muss ein deutscher, und wie ein isländischer Autor
seine Erzählgewohnheiten verändern, damit Sinn und Struktur einer
französischen Erzählung dem Verständnishorizont des heimischen Publikums
entsprechen und von diesem verstanden werden?
Geschichten sind seit jeher
zentraler Bestandteil kultureller Wissensvermittlung. Die unterschiedlichen
Arten und Strukturen, in denen Menschen Geschichten erzählen, geben
Aufschluss über deren Kultur, Denkweise und Weltsicht. In meiner Dissertation
untersuche ich die Entwicklung des Erzählens im europäischen höfischen
Roman (Iwein- und Tristan-Erzählungen) und damit
die teilweise sehr verschiedenen Herangehensweisen an ein- und dieselbe
Geschichte. Im Zentrum steht hierbei die Frage, ob und inwieweit die
Form des Erzählens mit dem Stoff der Erzählung gewandert ist und inwiefern
narrative Techniken der französischen Vorlagen von den deutschen,
englischen und isländischen Wiedererzählern übernommen wurden. Das
heißt: wie verändern sich Geschichten in anderen Kulturräumen, und
wie verändern sich deren Erzählmuster, um fremde Geschichten erzählen
zu können? Wie muss ein deutscher, und wie ein isländischer Autor
seine Erzählgewohnheiten verändern, damit Sinn und Struktur einer
französischen Erzählung dem Verständnishorizont des heimischen Publikums
entsprechen und von diesem verstanden werden?Meine Untersuchung konzentriert sich auf die Mikrostrukturen des (Wieder-)Erzählens, insbesondere die narrativen Funktionen der Figurenrede im Textgefüge der Geschichte. Sie analysiert das narratologische Verhältnis zwischen Figurenrede und Erzählerbericht und vergleicht die Art und Weise, in der die Dichter ihre Figuren für textbedingte Zwecke (Handlungsmotivation, Textaufbau und -entwicklung) und Erzählarbeit (Beschreibungen, Erklärung sinnstiftender Hintergründe und Zusammenhänge) verwenden.
Einhergehend mit den unterschiedlichen Erzählzielen der Dichter zeigt sich, wie verschieden eine inhaltlich gleiche Geschichte erzählt werden kann. Dies beschränkt sich keineswegs auf offenkundige Veränderungen wie die Übersetzung der altfranzösischen Endreimpaardichtung in altnordische Prosaerzählung, sondern erstreckt sich auf den Gebrauch des Reimes (als kommentierter Übergang bei Chrétien bzw. als Zeichen des Abschlusses bei Hartmann), auf den narrativen Status der Figuren (als eigenständige Informationsvermittler bei Chrétien im Gegensatz zum alleinwissenden Erzähler bei Hartmann) oder die Verwendung bestimmter Motive und Bildlichkeiten für erzählstrategisch vollkommen unterschiedliche Ziele. Die Untersuchung wird die verschiedenen Erzählstile zunächst klar voneinander abgrenzen und dann versuchen, Gemeinsamkeiten der Erzähler eines Sprachraumes bzw. Eigenheiten des europäischen Phänomens 'Artusliteratur' zu bestimmen. Sie wird Aufschluss darüber geben, welche Erzähltechniken Hartmann von Chrétien bzw. Gottfried oder Bruder Robert von Thomas übernommen (in einigen Fällen wohl auch gelernt) haben, und wo und warum sie sich den Vorgaben der Vorlagen verweigerten.
Zurück